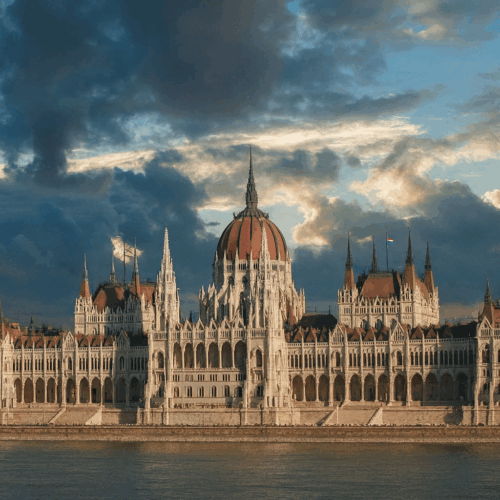Ungarns Wirtschaft hinkt ihren mitteleuropäischen Nachbarn hinterher. Nach Jahren des Rückgangs zeigen die Investitionen zwar erste Anzeichen einer Stabilisierung, doch politische Spannungen mit der EU und strukturelle Schwächen bremsen eine nachhaltige Erholung.
„Das Schlimmste scheint überstanden“, sagt Nicholas Farr, Ökonom für Schwellenländer bei Capital Economics. „Aber die anhaltenden Konflikte mit der EU und Überkapazitäten im Privatsektor werden die Erholung dämpfen.“
Farr sieht in den Parlamentswahlen im kommenden Jahr einen möglichen Wendepunkt: „Ein Sieg der Opposition könnte die Spannungen mit Brüssel entschärfen und die Wachstumsperspektiven deutlich verbessern.“
Ein Ausreißer in Mitteleuropa
Kaum ein Land der Region entwickelt sich derzeit so schleppend wie Ungarn. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im zweiten Quartal im Jahresvergleich um magere 0,1 Prozent – nur 1,4 Prozent mehr seit 2022. In Polen und Rumänien legte die Wirtschaft im selben Zeitraum um mehr als acht Prozent zu, in Tschechien um fast fünf.
Investitionen brechen ein
Hauptgrund für die Stagnation ist ein drastischer Investitionsrückgang. Seit Ende 2021 sind die Bruttoanlageinvestitionen real um 23 Prozent geschrumpft – während andere Länder Zuwächse verzeichneten. Zwar drücken auch in der Region hohe Zinsen und eine schwache Exportnachfrage auf die Investitionstätigkeit. Doch nirgendwo ist der Einbruch so stark wie in Ungarn.
„Zwei Faktoren sind ausschlaggebend“, erklärt Farr. Erstens habe die Regierung ihre öffentlichen Investitionen massiv gekürzt – ein zentraler Bestandteil ihrer Haushaltskonsolidierung, während andere Länder ihre Ausgaben ausweiteten. „Seit 2021 sind die staatlichen Anlageinvestitionen um zwei Prozentpunkte des BIP gesunken.“
Zweitens fließen deutlich weniger EU-Mittel ins Land. Wegen Streitigkeiten über Rechtsstaatlichkeit und Korruption hat Brüssel Gelder eingefroren. Die EU-Zahlungen fielen von rund drei Prozent des BIP im Jahr 2022 auf weniger als ein Prozent im vergangenen Jahr.
Auch die Unternehmen halten sich zurück. Zwar erreichte Ungarns Investitionsquote 2021 mit 27 Prozent den zweithöchsten Wert in der EU, doch viele dieser Investitionen waren offenbar überzogen. Zwischen 2016 und 2021 stiegen die Unternehmensausgaben für Maschinen und Anlagen um 60 Prozent – inzwischen sind sie um ein Fünftel gesunken. Besonders im verarbeitenden Gewerbe bleibt die Kapazitätsauslastung schwach.
Leichte Entspannung – mit Vorbehalt
Laut Capital Economics dürfte der Investitionsrückgang bald seinen Tiefpunkt erreicht haben. Mit einer Quote von rund 22 Prozent nähert sich Ungarn dem langfristigen Durchschnitt und den EU-Normen an. Sinkende Zinsen, abnehmende Inflation und eine erwartete Erholung in der Eurozone sprechen für eine moderate Belebung.
Doch die strukturellen Probleme bleiben. Im jüngsten Rechtsstaatlichkeitsbericht der EU-Kommission heißt es, Ungarn habe bei sieben von acht Reformempfehlungen keine Fortschritte gemacht. Verzögerte Zahlungen und institutionelle Unsicherheiten bremsen das Vertrauen – und damit neue Investitionen.
Capital Economics rechnet deshalb nur mit einem BIP-Wachstum von 0,5 Prozent im Jahr 2025 und zwei Prozent 2026 – deutlich unter den Markterwartungen.
Politischer Wendepunkt möglich
Für frischen Wind könnte die Wahl 2026 sorgen. Die neue liberale Bewegung Tiaza liegt in Umfragen vor Viktor Orbáns Fidesz-Partei.
„Ein Wahlsieg Tiazas könnte den institutionellen Rückschritt stoppen und die Beziehungen zur EU verbessern – das wäre ein echter Schub für Ungarns Wirtschaft“, sagt Farr.
Dieser Artikel entstand in Kooperation mit unserem Partner bne intelliNews