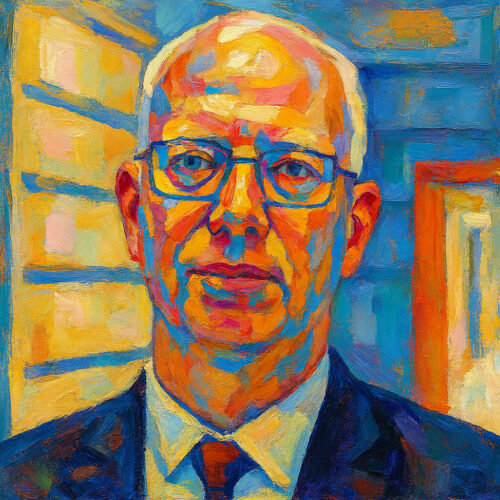Autor: Ben Aris, Chefredakteur bne Intellinews

Als ich Kirill Dmitrijew zum ersten Mal begegnete, galt er als eines der vielversprechenden Talente am Firmament der russischen Wirtschaft – einer jener westlich geprägten jungen Reformer, die ein neues, liberales Russland aufbauen sollten. Mit Abschlüssen von Stanford und Harvard, fließendem Englisch und einem Auftreten, das perfekt in jede Vorstandsetage des Silicon Valley gepasst hätte, arbeitete er damals im Rahmen eines von USAID finanzierten Reformteams. Dieses Team – u. a. mit Delta Credit Bank, unterstützt von US-Institutionen – sollte in Russland ein für die Nach-Sowjetzeit revolutionäres Produkt einführen: Hypotheken nach westlichem Modell.
Delta Credit legte den Grundstein für eine völlig neue Branche. 2003 nahm das Geschäft Fahrt auf – und explodierte regelrecht. Eine ganze Generation wollte ihre Wohnungen aus Sowjetzeiten hinter sich lassen; Umfragen zufolge träumte jede zweite russische Familie vom Umzug in eine moderne Wohnung. Delta Credit machte diesen Traum erstmals erreichbar – und löste damit einen der größten Immobilienbooms der 2000er Jahre aus.
Parallel baute Dmitrijew unter Delta Private Equity die russische Fondsbranche mit auf. Die unter Jelzin eingeführten PIFs zogen globale Investoren wie den legendären Mark Mobius (Franklin Templeton) ins Land, die auf eine prosperierende Mittelschicht setzten. Dmitrijew gründete die Russian Association of Direct and Venture Investment (RADVI) – ein zentrales Element einer damals entstehenden modernen Finanzindustrie.
Auch andere Talente jener Zeit schienen für eine liberale Ära geschaffen: Arkadi Dworkowitsch, in Schweden ausgebildeter Ökonom und Schüler des „jungen Reformers“ Anatoli Tschubais, stieg später bis zum Vizepremierminister auf. Heute leitet er den internationalen Schachverband. Dmitrijew hingegen rückte ins Zentrum der Macht – und wurde zu jenem Mann, der Zehntausende Milliarden Rubel aus der arabischen Welt nach Russland holen sollte.
Doch die Euphorie endete abrupt: Der Finanzkollaps vom August 1998 löschte die Boomjahre aus. Erst nach Putins Amtsantritt 2000 begann ein neues Jahrzehnt rasanter Expansion.
Von der Ukraine über McKinsey zum Architekten arabischer Investitionen in Russland
Dmitrijew sammelte Erfahrung bei McKinsey und Goldman Sachs, bevor er in die Ukraine wechselte: 2007 übernahm er die Leitung des Icon Private Equity-Fonds des Oligarchen Wiktor Pintschuk, Schwiegersohn des früheren Präsidenten Leonid Kutschma. Unter seiner Ägide wurden bedeutende Verkäufe abgewickelt: Delta Bank an General Electric, Delta Credit an Société Générale, Beteiligungen am Sender CTC Media an Fidelity Investments.
2011 bot man ihm den Posten an, der seine Karriere für immer prägen sollte: Chef des Russian Direct Investment Fund (RDIF) – eines milliardenschweren Staatsfonds, der ausländisches Private Equity ins Land holen sollte. RDIF-Mittel bilden bis heute einen Großteil der „nicht-liquiden“ Anlagen des Nationalen Wohlstandsfonds (NWF). Dmitrijew sitzt seither in den Aufsichtsräten von Gazprombank, Rostelecom, Alrosa, Transneft und Russischen Eisenbahnen – laut russischen Investigativjournalisten mit einem Jahresgehalt von rund 2 Mio. US-Dollar.
Kurz nach seiner Ernennung trafen wir uns auf dem Roten Platz, um für die Financial Times, für die ich schrieb, zu sprechen. Dmitrijew schien fest entschlossen, Russland im globalen Investorenkreis zu verankern. Er arrangierte Treffen zwischen Putin und einigen der größten Fondsmanager des Westens, um gemeinsame Vehikel aufzusetzen, bei denen RDIF als staatlicher Schutzschirm – ein krysha – fungieren sollte. Doch die Bemühungen verpufften: Die Erinnerung an 1998 war frisch, die Rechtslage unsicher, die Justiz politisiert, Minderheitsaktionäre ungeschützt – und der Bullenmarkt bis 2008 ohnehin attraktiv genug.
Der Durchbruch kam nicht in London oder New York, sondern im Nahen Osten. Ein RDIF-Manager mit skandinavischem Hintergrund flog auf Verdacht in die Golfstaaten – und fand, wie er später sagte, „eine offene Tür“. Die ersten Erfolge erzielte ausgerechnet Tatarstan, wo arabische Investoren sich im muslimisch geprägten Umfeld wohler fühlten als im rauen Moskau. Halal-Fleischwerke, Infrastruktur, Milliardeninvestitionen – die Region wurde zur Brücke in die Golfwelt.
Als der Kreml die Dimensionen erkannte, schickte selbst das Finanzministerium seine Spitzenbeamten zur Kasaner Investitionskonferenz, heute ein Schlüsselereignis russisch-arabischer Wirtschaftsdiplomatie – und 2024 auch Austragungsort des BRICS-Gipfels.
Dmitrijew nutzte diese neue Achse konsequent: Er holte die Staatsfonds Mubadala (Abu Dhabi) sowie Investoren aus Saudi-Arabien und Katar ins Land. „Die Araber investieren langsam – aber wenn sie investieren, dann sehr groß“, berichtete ein Manager von Mubadala später im Branchenjournal bne IntelliNews. Dmitrijew wurde zum zentralen Makler eines Deals nach dem anderen.
Seine Netzwerke erwiesen sich mehrfach als lebenswichtig für den Kreml. Als 2016 2 Billionen Rubel, nach damaligem Umrechnungskurs fast 30 Mrd. Euro, im Haushalt fehlten, wurde eine Scheinprivatisierung von 19% von Rosneft inszeniert; finanziert wurde sie – wie sich später herausstellte – durch ein 10-Milliarden-Dollar-Darlehen des katarischen Staatsfonds.
Dmitrijew als Vermittler im neuen Russland: Fundmanager, Diplomat, Machtfaktor
Während sich die Beziehungen zwischen den USA und Golfstaaten nach der US-Schieferrevolution abkühlten, wuchs Russlands Einfluss in der Region. Der historische Besuch des saudischen Königs Salman 2017 in Moskau markierte einen Wendepunkt: milliardenschwere Energieprojekte, Diskussionen über russische S-400-Systeme, engere OPEC+-Kooperation – und stets war Dmitrijew als inoffizieller Wirtschaftsbeauftragter Putins mit am Tisch.
Kronprinz Mohammed bin Salman (MbS) intensivierte diese Beziehungen weiter. Und bei der Aushandlung des Gefangenenaustauschs zwischen den USA und Russland im Frühling 2025 – der Rückholung des US-Lehrers Paul Fogel – spielte laut US-Unterhändler Steve Witkoff ein „Kirill aus Russland“ eine zentrale Rolle. Vieles deutet darauf hin, dass es Dmitrijew war, der mit seinen Kontakten im Nahen Osten, zu russischen Entscheidungsträgern und ins Umfeld von Trump-Schwiegersohn Jared Kushner als entscheidender Vermittler wirkte.
Seine Rolle ist kein Zufall. Dmitrijew war maßgeblich am Erfolg des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V beteiligt, der als erster Impfstoff weltweit registriert wurde und in vielen Schwellenländern hohes Prestige einbrachte – während westliche Staaten zunächst ihre eigenen Bestände horteten, was im Globalen Süden als „Impfstoff-Apartheid“ wahrgenommen wurde.
Sein persönliches Umfeld weist ebenfalls direkte Verbindungen in das Machtzentrum auf: Seine Frau Natalia Popowa, frühere Kollegin von Putins Tochter Katerina Tichonowa, arbeitete später für deren Institut und sorgte mit einem Leoparden als Haustier für Schlagzeilen. Dmitrijew selbst feierte opulente Partys, etwa auf den Sperlingsbergen, auf denen selbst der damalige Premier Michail Kassjanow erschien.
Parallel pflegte er enge Kontakte zu Vertretern der Trump-Administration. 2017 traf er in den Seychellen den US-Unternehmer Erik Prince sowie Vertreter der Emirate – ein Ereignis, das später im Fokus der Muller-Ermittlungen stand.
Wie groß sein Einfluss heute ist, lässt sich schwer beziffern. Doch vieles spricht dafür, dass Dmitrijew ein entscheidender Knotenpunkt eines neuen, hybriden Machtmodells ist in dem die Grenzen zwischen Staat, Wirtschaft, Diplomatie und persönlichen Netzwerken verschwimmen. Ein Modell, das in Russland extremer ausgeprägt ist als im Westen – und dessen Bedeutung in der entstehenden multipolaren Weltordnung stetig wächst.