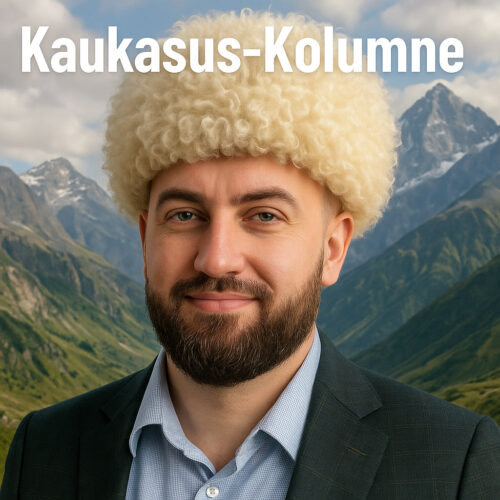Autor: Dietrich Schartner

Am 8. August 2025 verkündeten Armenien und Aserbaidschan in Washington eine Rahmenvereinbarung, die neben anderen Punkten auch exklusive US-Entwicklungsrechte an einem strategischen Transitkorridor vorsieht — dem so genannten Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP), häufig in der Debatte als Zangezur-Korridor bezeichnet. Der Deal stellt den Südkaukasus vor die Chance einer wirtschaftlichen Neuvermessung: Er könnte Transportwege, Energie- und Digitalinfrastruktur sowie Handel nachhaltig verändern.
Hintergrund und ökonomische Eckdaten
Der Zangezur-Korridor soll Aserbaidschans Kernland mit seiner Exklave Nachitschewan verbinden und eine direkte Landverbindung zur Türkei schaffen. Die geplante Infrastruktur umfasst Schienen- und Straßenverbindungen sowie Energie- und Glasfasertrassen — Elemente, die den Südkaukasus stärker in Eurasische Transportrouten (den sogenannten „Middle Corridor“) einbinden würden. Die Türkei hat bereits begonnen, eigene Baumaßnahmen vorzubereiten: Ankara legte Ende August 2025 den Grundstein für eine Schienenverbindung im Osten des Landes und sicherte nach offiziellen Angaben eine externe Finanzierung in zweistelliger Milliardenhöhe für Teilprojekte. Solche Investitionszusagen sind Indiz für die wirtschaftspolitische Zielsetzung: Transportkosten senken, Transitzeiten verkürzen und Logistikfunktionalität ausbauen.
Wachstumsimpulse, Wertschöpfung und Risiken
Ökonomisch bietet ein funktionsfähiger Transitkorridor mehrere Hebel. Erstens entstehen direkte Einnahmequellen durch Transitgebühren, Logistikdienstleistungen und Arbeitsplätze in Bau und Betrieb. Zweitens können niedrigere Transportkosten Exporten der regionalen Rohstoffe und Agrarprodukte (insbesondere aus Aserbaidschan) neue Märkte in Europa und Zentralasien öffnen. Drittens würde die Verlegung von Glasfaser und Energieinfrastruktur die digitale Anbindung Armeniens und Südkaukasus-Staaten verbessern und damit Investitions- und Standortattraktivität steigern. Studien und Policy-Analysen weisen darauf hin, dass integrierte Korridore die Wettbewerbsfähigkeit kleinerer Volkswirtschaften signifikant erhöhen können, sofern Sicherheits- und Governance-Risiken begrenzt bleiben.
Gleichzeitig sind die Risiken nicht zu unterschätzen. Infrastrukturprojekte in konfliktanfälligen Räumen leiden unter politischen Unsicherheiten: Verträge müssen rechtlich robust, Finanzierung gesichert und der Schutz kritischer Anlagen gewährleistet sein. Externe Akteure wie Iran und Russland haben offen Bedenken geäußert; eine politische Konfrontation mit Teheran oder eine strategische Gegensteuerung Moskaus könnte Investoren abschrecken und Kosten in die Höhe treiben. Zudem ist die innenpolitische Balance in Armenien fragil: Wahrgenommene Zugeständnisse an Baku oder an ausländische Entwickler können innenpolitische Opposition nähren, was wiederum Projektstabilität gefährdet.
Wer profitiert — wer verliert?
Kurzfristig sind die naheliegenden Gewinner die Transitakteure: Aserbaidschan gewinnt territoriale Verbindung und Transit-Einnahmen, die Türkei stärkt ihre Rolle als Logistikdrehscheibe, und internationale Infrastruktur- und Energiefirmen erhalten Aufträge. Für Armenien liegt die Chance in Transitmargen, in Arbeitsplätzen und in Investitionszuflüssen — vorausgesetzt, die Souveränitätsfragen und Rechtssicherheit werden transparent geregelt. Mögliche Verlierer sind Staaten, die heute an bestehenden Routen verdienen (etwa Iran für Transit in der Region), sowie lokale Wirtschaftszweige, die von der Umleitung bestehender Handelsströme negativ betroffen sein könnten. Zudem besteht das Risiko, dass Armenien zu stark von Transitgebühren und externen Akteuren abhängig wird, wenn keine dauerhafte Diversifizierung der Wirtschaft gelingt.
Ausblick
Ökonomisch hat der Zangezur-Transit das Potenzial, den Südkaukasus in eine Eurasische Drehscheibe zu verwandeln: kürzere Lieferketten, neue Exportmöglichkeiten und Infrastrukturmodernisierung würden spürbare Wachstumsimpulse bringen. Ob daraus jedoch ein nachhaltig positiver Entwicklungspfad wird, hängt von drei Bedingungen ab:
- 1. rechtlich verlässliche Vereinbarungen und transparente Governance
- 2. abgesicherte Finanzierung und operative Sicherheitsgarantien
- 3. eine regionale Einbindung, die negative Nebenwirkungen für Nachbarstaaten minimiert.
Scheitern eine oder mehrere dieser Voraussetzungen, drohen politische Gegenreaktionen, Investitionsstopps und ein Wiederaufleben von Spannungen — mit gravierenden Konsequenzen für die wirtschaftliche Perspektive des gesamten Südkaukasus. Beobachter sollten in den kommenden Monaten insbesondere die konkrete Vertragsgestaltung, die Finanzierungsflüsse und die Sicherheitsmaßnahmen verfolgen: Diese Elemente entscheiden, ob TRIPP wirtschaftlicher Motor oder geopolitischer Stolperdraht wird.