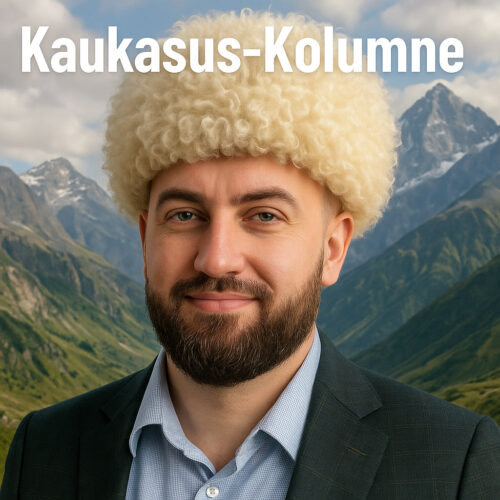Autor: Dietrich Schartner

Am 9. August 2025 hat Armenien mit der Unterzeichnung des Washingtoner Friedensabkommens einen tiefen Einschnitt vollzogen. Während die politische Dimension des Vertrags weithin diskutiert wird, liegt eine der größten Herausforderungen – und Chancen – in seinen wirtschaftlichen Auswirkungen. Für das traditionell isolierte Armenien eröffnet sich die Aussicht auf neue Handelswege, Investitionen und Partnerschaften. Gleichzeitig bleiben strukturelle Schwächen bestehen, die das Land in seiner Entwicklung bremsen könnten.
Geografische Sackgasse als Dauerproblem
Seit seiner Unabhängigkeit 1991 litt Armenien unter einer prekären geographischen Lage. Die Grenzen zu Aserbaidschan und zur Türkei waren jahrzehntelang geschlossen, der Zugang zu globalen Märkten stark eingeschränkt. Der Großteil des Außenhandels lief über Georgien und den iranischen Korridor – beides verwundbare Routen, die von regionalen Spannungen oder Sanktionen beeinflusst werden. Folge war eine überdurchschnittliche Abhängigkeit von Importen, hohe Transportkosten und eine fragile Versorgungssicherheit.
Der Sangesur-Korridor: Türöffner oder Risiko?
Das Washingtoner Abkommen sieht nun einen Transitkorridor durch die südarmenische Region Sangesur vor, der Aserbaidschan mit seiner Exklave Nachitschewan verbindet. Für Armenien bedeutet das paradoxerweise auch eine Öffnung: Der Korridor soll unter armenischer Hoheit betrieben werden und könnte erstmals direkte Anbindungen an die Türkei ermöglichen. Damit würde Eriwan Zugang zu einem der größten regionalen Märkte erhalten und zugleich Teil neuer Handelsrouten zwischen Zentralasien, dem Mittelmeer und Europa werden.
Internationale Beobachter erwarten, dass die „Trump-Route“, wie sie in den USA genannt wird, Investitionen in Logistik, Infrastruktur und Dienstleistungen nach sich zieht. Für Armenien könnte dies bedeuten, dass der lange diskutierte Ausbau der Schienen- und Straßenverbindungen endlich wirtschaftlich sinnvoll wird. Gleichzeitig bestehen Risiken: Kritiker warnen, dass Armenien lediglich Transitland bleibe und von den Wertschöpfungsketten zu wenig profitiere.
Chancen für Investoren
Die US-Regierung betonte bei der Vertragsunterzeichnung ausdrücklich, dass amerikanische Unternehmen „bereitstehen, Armeniens Wirtschaft in die Zukunft zu begleiten“. Beobachter gehen davon aus, dass Washington nicht nur politisches Interesse an Stabilität hat, sondern auch wirtschaftliche Projekte in Energie, Transport und Digitalisierung fördern möchte. Auch die EU signalisiert, Infrastrukturprojekte im Rahmen der Östlichen Partnerschaft stärker auf Armenien auszurichten.
Das Washingtoner Abkommen eröffnet Armenien wirtschaftlich eine historische Chance: Erstmals seit drei Jahrzehnten könnte das Land aus seiner geographischen Isolation ausbrechen und Teil überregionaler Handelsnetze werden. Doch die Umsetzung wird ein Balanceakt – zwischen Transitrolle und aktiver Wertschöpfung, zwischen geopolitischer Neuausrichtung und innenpolitischer Stabilität.
Gelingt es Armenien, Investitionen anzuziehen, seine Infrastruktur zu modernisieren und zugleich das Vertrauen internationaler Partner zu sichern, könnte das Land im kommenden Jahrzehnt zu einem Knotenpunkt im Südkaukasus aufsteigen. Scheitert der Prozess jedoch, droht Eriwan in einer neuen Form der Abhängigkeit zu verharren – diesmal nicht von Russland, sondern von den Interessen seiner Nachbarn.